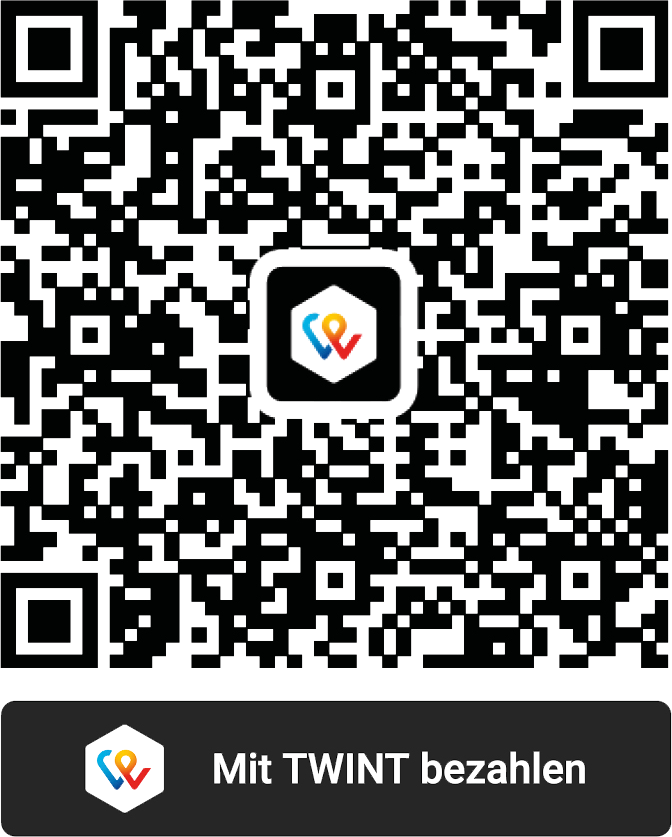Die Kolonisierung der so genannten Dritten Welt wird als historisches Phänomen betrachtet. In Wirklichkeit gehören koloniale Haltungen und Praktiken aber auch im 21. Jahrhundert noch zum Alltag.

Vor 200 Jahren erklärte in Lateinamerika ein Land nach dem anderen seine Unabhängigkeit von Spanien. Australien wurde 1907 unabhängig von Großbritannien, Indien 1947. Die Sklaverei wurde in den meisten Ländern im Laufe des 19. Jahrhunderts verboten, und die Kolonisation Afrikas endete spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg. Darauf folgte die Gründung der UNO unter dem Motto der Gleichwertigkeit aller Nationen. Doch wer behauptet, dass damit die Epoche des Kolonialismus endgültig abgeschlossen worden sei, macht sich etwas vor.
Ganz abgesehen davon, dass die natürlichen Ressourcen des Globalen Südens weiterhin schonungslos ausgebeutet werden, haben wir vor allem auch ein Haltungsproblem. Die Bilder, die die meisten im Kopf haben, wenn sie von der so genannten Dritten Welt sprechen, sind geprägt von einer unrealistischen und pauschalisierenden Überheblichkeit – und in den meisten Fällen merken wir das nicht einmal.
Der Diskurs von der ‹Hilfe für die Ärmsten der Armen› vermittelt ein klischeehaftes Bild des Südens.
Die Konstruktion von rassistischen Stereotypen, die die «Weißen» als physisch und moralisch überlegen darstellen, hat eine lange Geschichte. Um nur einige Eckpunkte zu nennen: Im Zuge der Plünderung Lateinamerikas im 16. Jahrhundert wurde behauptet, die dort lebenden Indigenen seien wie Tiere und hätten keine Seele. Die Physiognomik, die sich im 18. Jahrhundert dank dem Schweizer Pastor Johann Caspar Lavater hoher gesellschaftlicher Beliebtheit erfreute, wollte unter anderem beweisen, dass Schwarze in ihrer Entwicklungsstufe dem Affen näherstanden als dem Menschen. Und die «Rassenlehre» des Dritten Reiches diente als Rechtfertigung für den Mord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden.
Diese Sichtweisen mögen heute Empörung und Befremden auslösen, und man mag denken: «Heute wäre so etwas nicht mehr möglich!» Doch in Wirklichkeit hat sich die Grundhaltung gegenüber dem «Gobalen Süden» nicht wirklich verändert. Dies wird nicht nur in vielen Medien und Filmen deutlich, sondern auch in den Fundraising-Kampagnen der NGOs, die in Europa nach Spenden für ihre «Hilfsprojekte» suchen. Der Diskurs von der «Hilfe für die Ärmsten der Armen», begleitet von Bildern, die Not und Leid zeigen, vermittelt ein klischeehaftes Bild des Südens. Ganze Länder und Kontinente werden durch Armut und Ohnmacht charakterisiert, und es wird suggeriert, die Menschen befänden sich in einem Zustand von hoffnungsvoller Erwartung, von «weißen Helden» gerettet zu werden.
Ein Paradebeispiel von «guter Entwicklung»
Vor ein paar Jahren lancierte eine große Schweizer NGO eine Kampagne, die die positive Langzeitwirkung ihrer Projekte aufzeigen sollte. Auf den Bildern waren jeweils drei Generationen derselben Familie zu sehen. Während zum Beispiel die Großmutter konstatierte: «Ich baute Gemüse an», konnte der Vater bereits verkünden: «Ich baute meine Gärtnerei auf». Die Enkelin dagegen strahlte stolz mit einem Laptop in die Kamera und sagte: «Ich baue mein Studium auf.» Will heißen: Sie hat dank der Spenden-Hilfe aus der Schweiz das Niveau an Bildung und Technologisierung erreicht, das nach europäischen Werten als erstrebenswert betrachtet wird.
Gegen den Schul- oder Universitätsabschluss der Tochter sind die landwirtschaftlichen Kenntnisse der Großmutter nichts Wert. Die dritte Generation hat es so weit gebracht, sich einen Laptop und ein Mobiltelefon leisten und diese sogar noch bedienen zu können. Dies ist – laut Definition des zivilisierten Nordens – ein eindeutiges Zeichen von Entwicklung und Fortschritt. Dass die Förderung der Metalle, die für die Herstellung der angepriesenen Elektrogeräte nötig sind, am Wohnort der Familie zu gravierenden Umweltschäden führen könnte, wird in diesem Paradebeispiel der «guten Entwicklung» ebenfalls ausgeblendet. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass der Hautton der Tochter etwas heller ist als der der Eltern und der Großeltern: Mit ihrer «Entwicklung» ist die dritte Generation dem Ideal des weißen, modernen Menschen etwas näher gekommen.
Dies ist nur eins von vielen Beispielen für die klischeehafte Darstellung von Menschen aus anderen Regionen der Welt, die als hilfsbedürftig betrachtet werden. Natürlich gibt es viel «schlimmere», offensichtlichere Beispiele – in den meisten Fundraising-Kampagnen werden Menschen als Opfer dargestellt, um das Herz potenzieller Spender zu erweichen. Doch gerade die subtilere Visualisierung von Stereotypen ist heikel, weil sie uns unbewusst prägt. Statt echter Solidarität wird ein ungesundes Helfersyndrom propagiert, in dem wir aus einem Überlegenheitsgefühl heraus handeln – ein Mindset, in dem wir weit davon entfernt sind, andere ernst zu nehmen oder wertzuschätzen.
Ein Hilfsprojekt für arme, frierende Norweger
Einen interessanten Input für einen Perspektivenwechsel bietet in diesem Zusammenhang die Initiative «Radi-Aid». Auf ihrer Website findet man verschiedene Ratgeber für NGOs, um bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit nicht ins rassistische Fettnäpfchen zu treten. Zum Beispiel: «Wie kann man zeigen, dass die lokale Bevölkerung fähig ist, ihre Situation selbst zu verbessern? Wo sind die einheimischen Ärzte, Lehrer oder Entwicklungshelfer?» Oder: «Zeigt das Bild nur das Problem oder auch die Lösung?» Oder: «Werden die abgebildeten Personen als Menschen mit individuellen Erfahrungen und Gefühlen dargestellt?»
Das Beste – weil Eindrücklichste – ist aber ein sarkastisches Video über die fiktive NGO Africa Corp, die ein Hilfsprojekt für arme, frierende Norweger ins Leben ruft. Die Geschäftsführung des Hilfswerks ist schockiert und voller Mitleid, als sie erfährt, wie kalt die Winter in Nordeuropa sind. Sofort wird Nothilfe in Form von gespendeten Heizkörpern geleistet – doch in ihrer Planungssitzung diskutiert der Vorstand mehr darüber, wie gut sich die Fundraising-Kampagne von Africa Corp in den Sozialen Medien machen wird. Gesicht der Kampagne ist ein kleines blondes Mädchen, das traurig in die Kamera blickt.
«Bei uns dreht sich nicht alles ums Geschäft – es geht um die Menschen», betont der Geschäftsleiter. «Wir möchten denen etwas geben, die weniger Glück im Leben gehabt haben als wir. Sie brauchen uns jetzt mehr denn je – und schließlich verfügen wir über die notwendige Technologie, um ihr Leben zu verbessern.» Leicht kann man das Gefühl bekommen, hier eine übertriebene oder überspitzte Darstellung zu sehen. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine geradezu perfekte Persiflage einer Hilfskampagne, nur mit vertauschten Rollen: Der Süden hilft dem Norden, weil dieser überfordert ist und seine Probleme nicht allein bewältigen kann. ♦
Dieser Text hat Ihnen gefallen?
Die Inhalte von Tentakel sind frei verfügbar. Vielen Dank, wenn Sie unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Per Twint oder mit einem Klick auf den Button.