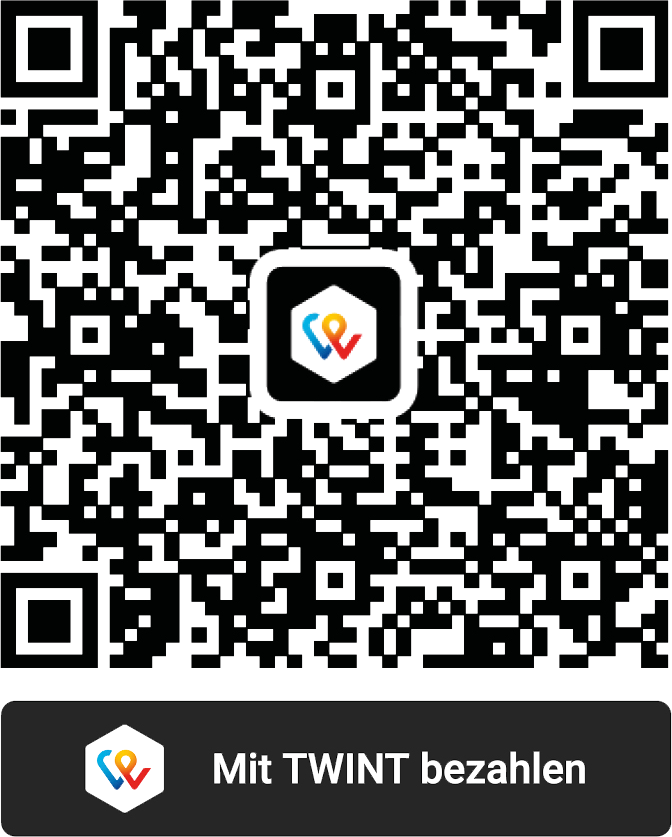Im südperuanischen Espinar werden Metalle aus der Erde geholt, die auch in unseren Handys und Computern landen. Wer sich gegen die verursachte Umweltverschmutzung wehrt, wird mundtot gemacht. Reportage.
 Das Glencore-Bergwerk befindet sich in nächster Nähe von 13 indigenen Gemeinden. Foto: Miguel Gutierrez
Das Glencore-Bergwerk befindet sich in nächster Nähe von 13 indigenen Gemeinden. Foto: Miguel Gutierrez Man muss um die Mittagszeit herkommen, um die Sprengungen im Bergwerk zu filmen. Natürlich darf das Gelände nicht betreten werden – es ist mit einem hohen Stacheldrahtzaun abgesperrt. Doch von den umliegenden Hügeln aus sieht man den enormen Krater deutlich. Wie ein Schlund, der sich in der Erde auftut und droht, die herumwieselnden Arbeiter und Fahrzeuge zu verschlingen, die von hier oben ameisenklein aussehen. Doch in Wirklichkeit verschlingt die Erde gar nichts – im Gegenteil. Die Mine verschlingt die Erde. Stufe um Stufe wurde hier weggesprengt, um an die Mineralien zu kommen, die sich unter dem Boden befinden: Gold, Silber, Kupfer. Der Fels ist rot verfärbt, die umliegenden Flüsse sind ausgetrocknet oder führen schlammiges, schäumendes Wasser: Abwasser aus dem Bergwerk. Tiere und Menschen, die ihr Trinkwasser aus Bächen oder Lagunen dieser Zone beziehen, werden schwer krank, bringen Kinder mit Missbildungen zur Welt. Die Feinstaubbelastung führt zu Lungenbeschwerden, die Kontamination der Böden zur Vergiftung der Nahrungsmittel.
Trotzdem wird im Bergwerk weitergearbeitet, unaufhörlich, seit vierzig Jahren. Jeden Tag eine Sprengung. Kurz vor zwölf beginnt eine Sirene zu heulen, das an- und abschwellende Geräusch geht durch Mark und Bein. Es ist die Warnung für die Arbeiter, dass es gleich losgeht. Die schweren Fahrzeuge bleiben stehen, und es breitet sich eine gespenstische Stille aus. Dann – es trifft einen ohne Vorwarnung, obwohl man weiss, dass es kommt: ein Grollen, das langsam lauter wird und sich in Wellen ausbreitet, nicht nur in der Luft, sondern auch unter dem Boden. Als ob sich die Erde, als ob sich der ganze Hügel aufbäumen würde. Kein Zittern und Schütteln wie bei einem Erdbeben, sondern ein einmaliges, aber heftiges Erheben. Und man fühlt bis in den Bauch hinein, dass hier einem lebendigen Organismus Schmerzen zugefügt werden. Fühlt wie die Erde sich windet, als das Dynamit in ihrem Leib explodiert. Es ist ein Schauer, den man bis ans Lebensende nicht vergisst. Aus dem Bergwerk steigt langsam, wie in Zeitlupe, hellgrauer Rauch auf.

Von den Behörden im Stich gelassen
Die Mineralien, die hier im südperuanischen Espinar abgebaut werden, gehören dem Schweizer Konzern Glencore, einem der größten Rohstoffhändler der Welt. Für die Ausbeutung des eingezäunten Landes hat das Unternehmen vom peruanischen Staat Konzessionen erhalten, die ihm die Nutzung erlauben. Gerade wurde eine Erweiterung der Mine bewilligt, so dass die begehrten Rohstoffe mindestens noch zwanzig Jahre lang abgebaut werden dürfen. Doch das umliegende Land gehört indigenen Bäuerinnen und Bauern, deren Leben sich komplett verändert hat, seit hier Bergbau betrieben wird. Wer es geschafft hat, seine Parzellen und Viehweiden zu behalten, muss schauen, wie er mit den neuen Verhältnissen klarkommt.
Weder der Staat noch Glencore kümmern sich groß um die Probleme der ursprünglichen Besitzer dieses Gebietes. Die Linie der Vorfahren, die vor den heutigen Bewohnern hier gelebt haben, reicht Generationen weit zurück. Und immer hat es an erster Stelle gestanden, das Land, die Äcker, das Vieh und das Wasser zu schützen – denn sie bilden die Lebensgrundlagen der Menschen. Heute ist das nicht mehr möglich, denn ein Konzern hat die Kontrolle über das Land übernommen. Und der Schaden, den er anrichtet, geht weit über das Gebiet hinaus, das fein säuberlich abgesperrt wurde.
Plötzlich begann das Vieh zu sterben und die Menschen wurden krank.
«Als ich ein Kind war, spielte ich mit meinen Freundinnen und Cousins am Fluss», erinnert sich Ariana Kana, die in der Gemeinde Huisa aufgewachsen ist – in nächster Nähe des heutigen Bergwerks. «Damals gab es noch Forellen, die inzwischen auf Grund der Verschmutzung längst verschwunden sind. Aber an einigen Stellen begann sich das Wasser bereits zu verfärben, und es bildete sich ein bleifarbiger Belag, so dass wir nicht mehr bis auf den Grund sehen konnten.» Sie schließt immer wieder die Augen, während sie spricht, als ob alles Erlebte von neuem an ihr vorüberziehen würde. Ihr Gesichtsausdruck wechselt zwischen Bitterkeit, Wut und wilder Hoffnung, trotz allem etwas bewirken zu können. «Wir dachten, das sei natürlich, und spielten mit den Wasserschichten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es toxisches Abwasser aus dem Bergwerk war und wir uns mit Arsen, Blei und Quecksilber vergifteten.» Doch dann begann plötzlich das Vieh zu sterben und die Menschen wurden krank. Am Fluss gab es keine Frösche und Vögel mehr.
2020, mitten in der Pandemie, war Kanas Mutter plötzlich halbseitig gelähmt. Bei medizinischen Untersuchungen kam heraus, dass sie unter großer Schwermetallbelastung litt. Sie hatte Arsen, Blei, Kadmium und weitere Substanzen im Blut, die dazu führten, dass ihr Zentralnervensystem zu versagen begann. «Sie wäre fast gestorben und wir versuchten, Hilfe zu bekommen. Die Bergbaugesellschaft sagte, darum solle sich die Gemeinde kümmern, doch wir waren nicht die einzigen hier mit diesem Problem. Eigentlich gibt es keine Familie, die nicht betroffen wäre. Ich gelangte an die Ombudsstelle der Zivilgesellschaft, doch die sagte mir, sie könne nur bei Problemen mit staatlichen Stellen helfen und nicht, wenn es um private Unternehmen ginge. Dann rief ich das Frauenministerium an, aber dort hieß es, sie kümmerten sich nur um Fälle von häuslicher Gewalt. In diesem Moment verstand ich, dass wir hier von allen Behörden im Stich gelassen werden.»

Diskriminierung gehört zur Tagesordnung
Wie viele Indigene bewegt sich Kana zwischen zwei Welten – der dörflichen Gemeinschaft, in der Traditionen gepflegt werden, und der Großstadt, wo das so genannte moderne Leben spielt und Politik gemacht wird. Doch die indigene Identität kann sie nicht nach Belieben an- und ablegen. Sie trägt sie in Herz und Geist mit sich, egal wo sie ist. Denn sie verbindet sie nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit ihren Ahninnen und Ahnen – und mit deren Territorium.
«In einer Gemeinschaft aufzuwachsen bedeutet zu lernen, wie man harmonisch zusammenlebt – nicht nur mit der Natur, sondern auch mit anderen Menschen», sagt Kana. «Alle unterstützen sich gegenseitig, egal ob sie etwas haben oder nicht. Ich erinnere mich an meine Kindheit: An den Tagen, an denen wir Gemeindearbeit leisteten, bauten wir zum Beispiel Mauern für den Friedhof oder die Schule, oder Bewässerungskanäle.» Mit Schulbeginn aus dieser Welt herausgerissen zu werden, ist für viele indigene Kinder ein Schock. Dazu kommt, dass die Sprache, die sie sprechen, plötzlich nichts mehr Wert sein soll – genauso wenig wie ihr Nachname. Denn die indigene Kultur und Identität wird bis heute abgewertet. Wenn man Quechua, Aymara oder eine andere indigene Sprache spricht oder Spanisch mit Akzent, wird man in der Schule blöd angeschaut. «Sie sagten uns, wir müssten jetzt Spanisch sprechen und unsere Muttersprache vergessen», erinnert sich Kana. «Wir erfahren schon als Kinder, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem es große soziale Unterschiede gibt und in dem Diskriminierung zur Tagesordnung gehört.»
So werden die Leiden der indigenen Bevölkerung, die als rückständig und bockig betrachtet wird, nicht groß in Betracht gezogen, wenn es um den wirtschaftlichen Aufschwung geht, den der Bergbau bringt. Das Siechen von Mensch und Natur in den Bergbaugebieten wird sozusagen als Kollateralschaden abgetan – ein bedauerliches, aber notwendiges Opfer des Fortschritts.
Über ein Drittel der Haushalte haben keinen Strom und kein Abwassersystem.
Wobei: Vom Fortschritt sehen die indigenen Gemeinden nicht viel – in keinem Bereich. Eine Studie von Amnesty International aus dem Jahr 2021 zeigt, dass die Bevölkerung der 13 Gemeinden im Einflussbereich des Glencore-Bergwerks in Armut lebt. Über ein Drittel der Haushalte haben keinen Strom und kein Abwassersystem, mehr als die Hälfte der Menschen ist nicht krankenversichert, und fast zwei Drittel haben keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten. In der gesamten Provinz ist fast die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren von chronischer Unterernährung betroffen. Bereits 2013 wies Espinar die landesweit höchste Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen und die dritthöchste Kindersterblichkeitsrate auf. Die häufigsten Todesursachen bei Kindern zwischen einem und vier Jahren waren Hirngefäßkrankheiten, Leberzirrhose, chronische Lebererkrankungen und Niereninsuffizienz.
«Sie lassen uns hier langsam sterben»
Der Bergbau ist eine der wichtigsten Stützen der peruanischen Wirtschaft. Er macht zehn Prozent des Bruttoinlandproduktes und mehr als sechzig Prozent der Gesamtexportsumme aus. «Unser Land ist ein Schatz, den es zu erforschen gilt», sagt das Ministerium für Energie und Bergbau. Tatsächlich sind mehr als 14 Prozent des peruanischen Territoriums für Bergbauaktivitäten konzessioniert. Nach Angaben des peruanischen Wirtschaftsinstituts IPE verfügt Peru über die größten Silberreserven der Welt, die drittgrößten an Kupfer und Zink und die fünftgrößten an Gold.

Doch warum sind diese Metalle so begehrt? Weil sie benötigt werden, um den so genannten Fortschritt aufrecht zu erhalten. Wer kann sich heute noch vorstellen, ohne Mobiltelefon und ohne Computer zu leben? Denn in diesen Geräten stecken mehr Rohstoffe, als viele sich bewusst sind. Ein Handy enthält mehr als dreißig Metalle, unter anderem Gold, Silber, Kupfer und Zink. Laut Recherchen der Schweizer NGO Public Eye ergibt sich daraus ein jährlicher Bedarf von 16‘000 Tonnen Kupfer, 6800 Tonnen Kobalt und 43 Tonnen Gold. Und ein viel zu großer Teil davon liegt brach: In der Schweiz werden Mobiltelefone durchschnittlich zwei bis drei Jahre lang genutzt, und nur zwanzig Prozent der Geräte werden recycelt.
Eine kürzlich durchgeführte Studie von Rebuy Deutschland zeigt, dass in Kanada, den Vereinigten Staaten, Neuseeland und 24 europäischen Ländern etwa 771 Milliarden Mobiltelefone lagern, die zwar noch funktionieren, aber nicht benutzt werden. Diese Geräte enthalten Metalle im Wert von fast zwei Milliarden Euro. Der auf diese Weise anfallende Elektroschrott beläuft sich auf 24‘000 Tonnen, was 54 Passagierflugzeugen entspricht.
Den Preis dafür zahlt die ländliche Bevölkerung in Peru und in anderen Ländern des Globalen Südens, meist indigene Gemeinden. Wie die Studie von Amnesty International zeigte, weisen 78 Prozent der Menschen in den Gemeinden rund ums Bergwerk hohe Werte an Metallen und toxischen Substanzen auf – insbesondere Blei, Kadmium, Arsen, Quecksilber und Mangan. «Die Schwermetallbelastung ist bei vielen Menschen in Espinar chronisch», sagt die peruanische Biologin Karem Luque, die seit Jahren betroffene indigene Gemeinden begleitet. «Was dabei im Körper passiert, ist Folgendes: Die Metalle gelangen in den Körper und werden über den Blutkreislauf in die Organe transportiert. Dort sammeln sie sich an und können die Zellen so sehr beschädigen, dass Krebs entsteht. Doch das ist noch nicht alles: Die DNA der Menschen verändert sich, das heißt es gibt genetische Schäden, die an die nächste Generation weitervererbt werden.»
Zwanzig Jahre Haft für Protest
Der Bergbau fordert Menschenleben. Doch nicht nur auf Grund der Vergiftung von Luft, Böden und Gewässern. Menschen, die für ihr Recht auf Gesundheit und eine intakte Umwelt einsetzen, leben gefährlich. Zum Beispiel Oscar Mollohuanca, der ehemalige Bürgermeister von Espinar, selbst aus einer indigenen Gemeinde nah des Bergwerks. Mollohuanca, der immer bescheiden blieb und nie ausfällig wurde, auch wenn er allen Grund dazu gehabt hätte. Er wählte seine Worte stets mit Bedächtigkeit und war immer ernst, lächelte wenig. Als er von der Konzerninitiative hörte, über die die Schweiz im November 2020 abgestimmt hatte, drückte er Dankbarkeit und Hoffnung aus. «Schade, dass es nicht geklappt hat. Ich möchte trotzdem alle Menschen grüßen, die sich dafür eingesetzt haben», sagte er in einem seiner letzten Interviews. «Ich bitte Sie inständig, in diesem Bemühen fortzufahren und weiterhin die Probleme aufzuzeigen, die wir hier auf Grund der Ausbeutung erleben.»
Mollohuanca kämpfte jahrelang an vorderster Front dafür, dass die Bevölkerung der betroffenen Gemeinden in Espinar Zugang zur Grundversorgung erhalten. Weil er 2012 an einem Protestmarsch teilnahm, forderte der zuständige Staatsanwalt eine Haftstrafe von zwanzig Jahren und eine Buße von fünf Millionen Soles (1’200’000 Franken). Die Polizisten dagegen, die bei diesen Protesten drei Menschen getötet hatten, mussten sich in keiner Weise dafür verantworten – ihre Akten wurden archiviert.
Die Wahrheit zu berichten, ist zu einem Delikt geworden.
Mitte Dezember 2020 wurde Mollohuanca in erster Instanz freigesprochen, worauf die Staatsanwaltschaft Einspruch einlegte. Den endgültigen Ausgang des Prozesses sollte Mollohuanca aber nicht mehr erleben: Er wurde am 7. März 2022 auf einem Hügel in der Nähe seines Hauses tot aufgefunden. Die Umstände seines Todes wurden bis heute nicht aufgeklärt. Es wird vermutet, dass er Opfer eines Verbrechens wurde – ob auf Grund seines Kampfs gegen den Bergbau oder wegen anderer politischer Aktivitäten, lässt sich nicht sagen.
Polizeigewalt gegen Journalisten und Ärztinnen
Auch Journalisten leben gefährlich in Espinar. Der Lokalreporter Vidal Merma, der seit 15 Jahren über die Bergbauproblematik berichtet, wurde mehrfach angegriffen, angezeigt und bedroht. «Im Juli 2020 hat die Polizei auf mich geschossen, weil ich bei Protesten gefilmt und fotografiert habe, doch zum Glück hat mich die Kugel nicht getroffen», sagt er, mit einer Miene, die einem zu verstehen gibt: Das ist nichts Besonderes, sondern gehört in Espinar fast zum Alltag. «Bei anderen Gelegenheiten wurde meine Kamera zerstört, doch ich habe mich immer wieder neu ausgerüstet, um sichtbar zu machen, was hier passiert. In Peru gibt es keine Pressefreiheit. Die Wahrheit zu berichten, ist zu einem Delikt geworden.»

Das musste auch die Ärztin Gloria Cárdenas erfahren, die nach einer Schießerei im Juli 2020 den Medien gegenüber bestätigte, dass sie im Spital von Espinar drei Verletzte behandelt hat, die an Armen und Beinen Durchschüsse von scharfer Munition aufwiesen. «Auf sie wurde geschossen, und zwar nicht nur mit Gummischrot und Tränengaspatronen, sondern mit Kugeln», sagte sie in einem Interview mit Vidal Merma. «Was hier passiert, ist unerhört. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei Menschen angreift und verletzt, die nichts Anderes tun als für ihre Rechte zu protestieren.» Wenige Tage nach ihrer Aussage wurde Cárdenas selbst von der Polizei eingeschüchtert und erhielt eine Vorladung der Staatsanwältin von Espinar. «Falls mir etwas zustoßen sollte, müsst ihr wissen, dass dies kein Zufall oder Unglück ist», sagte sie.
Als das Beben der Sprengung abflaut und das Treiben im Bergwerk wieder beginnt, hat die Kamera nicht viel Brauchbares aufgenommen. Man hört die Sprengung, sieht den Rauch – doch kein Foto und kein Video kann wiedergeben, wie es sich anfühlt, hierzustehen. Der Versuch, die Tragweite der Ausbeutung von Mensch und Umwelt mit Bildern oder Worten verständlich zu machen, bleibt immer hinter der Realität zurück. Doch diejenigen, die gegen den Bergbau und für ihr Leben kämpfen, geben trotz Wut und Verzweiflung die Hoffnung nie ganz auf. Auch die Hoffnung darauf, dass Menschen überall auf der Welt verstehen, wie das Leben aller miteinander verbunden ist: Die Rohstoffe, die wir in Europa konsumieren, hinterlassen anderswo gravierende Spuren. Doch diese so genannten Kollateralschäden können nicht für immer ausgelagert werden. Über kurz oder lang werden sie alle betreffen. ♦
Der Dokumentarfilm «Das Blut des Flusses» von Nicole Maron und Vidal Merma zeigt die Situation in Espinar auf und setzt sie in Verbindung mit der Verantwortung des Globalen Nordens.
Dieser Text hat Ihnen gefallen?
Die Inhalte von Tentakel sind frei verfügbar. Vielen Dank, wenn Sie unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Per Twint oder mit einem Klick auf den Button.