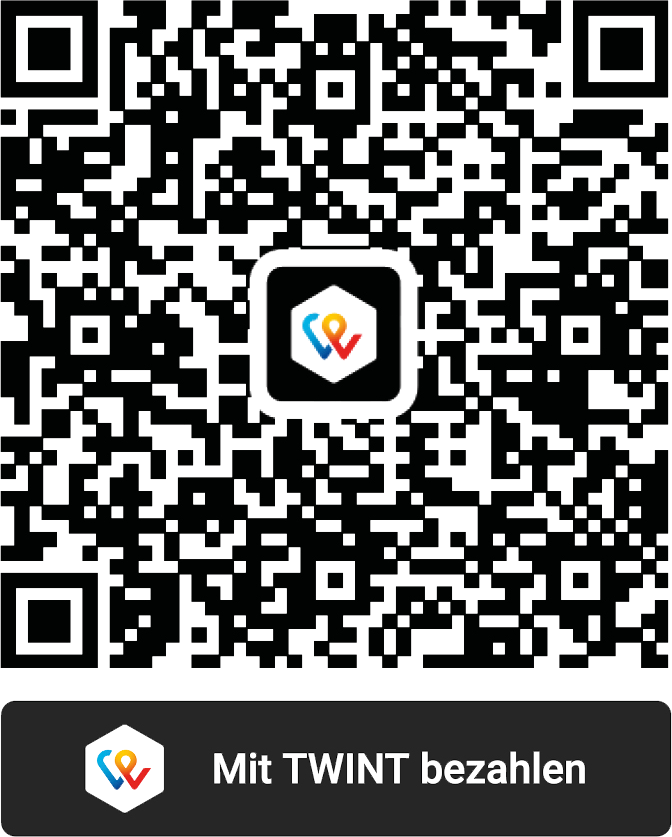Frauen werden oft medizinisch schlechter behandelt als Männer. Schuld sind Vorurteile und mangelndes Wissen über weibliche Körper. Doch es tut sich was.
 Foto: yayangart
Foto: yayangart Lina Chopra* erduldete drei Jahre lang jeden Monat starke Beschwerden. «Wenn ich während meiner Tage auf die Toilette musste, hatte ich stechende Schmerzen und Krämpfe. An gewissen Tagen hielt ich es kaum aus»», sagt sie. Lange sah sie davon ab, ihre Ärztin zu kontaktieren. «Ich dachte, solche Schmerzen seien vielleicht normal. Ich hatte Angst, als Memme zu gelten.»
So wie Lina geht es vielen Frauen. Studien zeigen, dass insbesondere jüngere Frauen ihre Beschwerden wenig ernst nehmen oder zuwarten, bis sie sich untersuchen lassen. Ein Grund dafür sind geschlechtsspezifische Vorurteile, die in der Medizin tief verankert sind und die das Recht auf Gesundheit von allen Menschen, die sich als Frauen identifizieren, stark beeinträchtigen.
Laut Cathérine Gebhard, Kardiologin und Expertin für Gendermedizin am Inselspital in Bern, wurden Geschlechtsunterschiede in der Forschung, in der Prävention und in der Behandlung von Patientinnen lange ignoriert – mit teilweise fatalen Auswirkungen. So werden Schmerzen bei Frauen bis heute eher auf emotionale oder psychologische Ursachen zurückgeführt als auf physische – und entsprechend mit Beruhigungsmitteln und Antidepressiva behandelt statt mit schmerzstillenden Medikamenten.
Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass Ärzte und Ärztinnen Männer mit chronischen Schmerzen häufig als «tapfer» ansehen, Frauen mit chronischen Schmerzen dagegen als «emotional» oder gar «hysterisch». Eine weitere im Jahr 2018 durchgeführte Umfrage der Universität Florida unter Ärztinnen und Zahnärzten kam zu ähnlichen Ergebnissen: Viele dieser Fachleute glaubten, dass Frauen ihre Schmerzen übertreiben.
Ähnliches erlebte auch Lina. Als sie ihre Gynäkologin endlich auf ihre Beschwerden ansprach, tat die Ärztin diese als normale Regelschmerzen ab und verzichtete auf weitere Untersuchungen. «Ich fühlte mich überhaupt nicht ernst genommen », sagt Lina. Statt ihr zuzuhören, kommentierte die Gynäkologin bloß Linas Gewicht. «Ich hatte während kurzer Zeit etwas zugenommen. Wie sich später herausstellte, war dies auf eine Schilddrüsenunterfunktion zurückzuführen.» Lina begann, mit Freunden und Freundinnen darüber zu sprechen und selbst zu recherchieren. Obwohl ihre Symptome nicht zu hundert Prozent mit den üblichen Diagnosen übereinstimmten, wuchs ein Verdacht: Endometriose, eine krankhafte Gewebewucherung an Eierstöcken, im Becken- oder Bauchbereich. «Ich wollte mich direkt in einer Endometriose-Klinik anmelden, war mir aber nicht sicher, ob meine Schmerzen dafür stark genug waren. Deshalb wartete ich zu», sagt Lina. Doch dann landete sie im Notfall.
Von der Forschung ignoriert
Obwohl laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit jede zehnte Frau von Endometriose betroffen ist, bleibt die Krankheit oft unerkannt. Im Schnitt vergehen sieben bis neun Jahre, bis eine Endometriose diagnostiziert wird. Und das, obwohl die Krankheit die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigt und zu Unfruchtbarkeit führen kann.
Nicht nur bei frauenspezifischen Beschwerden warten Betroffene lange auf die richtige Behandlung. Eine britische Studie ergab, dass Frauen deutlich länger auf eine Krebsdiagnose warten müssen als Männer. «Zudem haben Frauen mit Herzkreislauferkrankungen weniger gute Chancen als Männer, intensivmedizinisch betreut zu werden», sagt Cathérine Gebhard. Vor allem jüngere Frauen müssten deutlich kränker sein als gleichaltrige Männer, um auf die Intensivstation aufgenommen zu werden, wie eine Schweizer Studie von 2021 herausfand.
«Waren Sie Ihrem Partner auch treu?»
Lina wachte eines Nachts mit unerträglichen Schmerzen auf. Sie fuhr in den Notfall. «Ich hatte gehofft, dass mir hier jemand zuhört», sagt Lina. Doch der Notfallaufenthalt entwickelte sich zur Katastrophe. Es begann damit, dass der zuständige Pfleger nicht glaubte, dass sie halbprivat versichert sei. «Ich hatte das Gefühl, beurteilt und in eine Klasse eingeteilt zu werden – ob wegen meines Alters, meines Geschlechts oder meiner Hautfarbe kann ich nicht sagen», sagt Lina.
Der zuständige Arzt fragte Lina dann mehrfach, ob sie ihrem Partner auch treu gewesen sei – Geschlechtskrankheiten könnten oft zu Problemen beim Harnlassen führen. Es wurden mehrere Tests durchgeführt, doch wirklich verstanden fühlte sich Lina nicht. «Statt mich genauer zu untersuchen, kommentierte der zuständige Arzt nur die Größe meines Bauchbereichs», sagt sie. «Die Bemerkung verletzte mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Arzt diesen Kommentar gemacht hätte, wenn ich ein Mann gewesen wäre.» Da die Ärzteschaft keine Diagnose stellen konnte, wurde Lina aus dem Notfall entlassen – noch immer mit starken Schmerzen.
Ein Grund für die Diskriminierung von Frauen in der Medizin ist die Tatsache, dass der Mann lange als medizinischer Prototyp galt. Männer galten als die besseren Versuchspersonen, weil sie keine Menstruationszyklen haben und nicht schwanger werden können. Während eines Großteils der dokumentierten Medizingeschichte wurden Frauen von der medizinischen Forschung ausgeschlossen. Das Wissen über die weibliche Biologie konzentrierte sich auf deren Fähigkeit – und Pflicht – zur Fortpflanzung.
«Medikamentenstudien wurden lange Zeit überwiegend an Männern durchgeführt, wodurch viele Medikamente auf Männer optimiert sind», sagte Cathérine Gebhard. Dies hatte zur Folge, dass schwere, unerwünschte Nebenwirkungen bei Frauen fast doppelt so wahrscheinlich sind. Anlass für den Ausschluss von weiblichen Testpersonen war unter anderem die Furcht vor Schäden am Kind nach dem Contergan-Skandal in den 1960er-Jahren, als viele Kinder mit Fehlbildungen zur Welt kamen, weil die Mütter während der Schwangerschaft das Schlafmittel Contergan eingenommen hatten.
Dass Frauen systematisch aus der medizinischen Forschung ausgeschlossen wurden, hatte fatale Folgen in der Praxis. So galt der Herzinfarkt lange als typische Männererkrankung. Wenn eine Frau einen Herzinfarkt erlitt, wurde dieser deshalb oft erst spät erkannt und behandelt. Denn bei einem Herzinfarkt verspüren Frauen neben dem typischen Brustschmerz oft weitere Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, die dann fehlgedeutet werden.
Gendermedizin auf dem Vormarsch
Eine solche Fehldiagnose erlebte auch Lina. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen und wechselte ihre Gynäkologin. Die neue Ärztin verwies sie an einen Spezialisten. Ihr Verdacht auf Endometriose wurde bestätigt. Lina ist der Meinung, dass Krankheiten, die Frauen betreffen, ernster genommen werden müssen und dass Ärzte und Ärztinnen sich in gewaltfreier Kommunikation üben sollten. «Wie sie mit mir sprachen, war ziemlich unsensibel», sagt sie.
«Gerade bei der Kommunikation fehlt oft die Sensibilisierung auf Geschlechterunterschiede», bestätigt Cathérine Gebhard. So sei bekannt, dass Frauen ausführlicher erzählen und später auf den Punkt kommen würden. Viele Ärzte würden bereits nach wenigen Sekunden unterbrechen, obwohl sie die Kernpunkte dann oft noch nicht gehört hätten, und so eine Fehldiagnose riskieren.
Laut Gebhard würden nicht nur Frauen von einem genderspezifischen Ansatz profitieren. «Essstörungen, Depressionen oder Osteoporose werden beispielsweise immer noch als typische Frauenkrankheiten wahrgenommen», sagte Cathérine Gebhard. Das führe dazu, dass diese Erkrankungen bei Männern seltener diagnostiziert und adäquat behandelt würden. Auch non-binäre und trans Personen, deren Diagnosen und Behandlungen oft von Diskriminierung beeinträchtigt sind, würden von gendersensitiven Ansätzen in der Medizin profitieren.
Es dauerte lange, bis Behörden, medizinische Zeitschriften und Ethikkommissionen begannen, darauf zu bestehen, dass bei Forschungsstudien Männer und Frauen gleichermaßen repräsentiert sind. «Mittlerweile haben Forschende jedoch erkannt, dass Männer und Frauen oft unterschiedlich erkranken und eine geschlechtssensitive Behandlung und Medikamentendosierung benötigen», sagt Gebhard. Dies auch aufgrund der Covid-Pandemie, bei der Männer im Schnitt schwerer an Covid-19 erkrankten als Frauen. Heute verlangt Swissethics, die Dachorganisation der kantonalen Ethikkommissionen, dass in Studien beide Geschlechter vertreten sind. Für den Einbezug von schwangeren Frauen gibt es spezifische Richtlinien, die die Sicherheit des ungeborenen Kindes gewährleisten sollen.
Der Nationalrat verlangt, dass die Nachteile des Frauseins in der Medizin behoben werden.
Um die Geschlechterunterschiede in der Medizin besser zu verstehen, haben mehrere Schweizer Universitäten die Lehre und die Forschung im Bereich Gendermedizin intensiviert. Ab nächstem Jahr gibt es auch ein Nationales Forschungsprogramm im Bereich Gendermedizin in der Schweiz. Auch die Politik wurde aktiv: Der Nationalrat verlangt, dass die Nachteile des Frauseins in der Medizin behoben und frauenspezifische Krankheiten besser erforscht werden. «Wir gehen in die richtige Richtung», sagt Gebhard, «aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis ein geschlechtersensibler Ansatz in der Medizin breit akzeptiert und auch in der Praxis eingebunden ist.»
Lina erhielt endlich die nötige Behandlung und unterzog sich einem Eingriff, bei dem die Endometrioseherde im Unterbauch entfernt wurden. «Die Operation zeigte sofort Wirkung», sagte Lina. Gemeinsam mit ihrem Partner konnte sie endlich ihren Kinderwunsch verfolgen. Mit Erfolg: Lina ist schwanger und kann es kaum erwarten, Mutter zu werden. ♦
*Name von der Redaktion geändert
Erschien erstmals in «AMNESTY – Magazin der Menschenrechte», September 2023.
Dieser Text hat Ihnen gefallen?
Die Inhalte von Tentakel sind frei verfügbar. Vielen Dank, wenn Sie unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Per Twint oder mit einem Klick auf den Button.