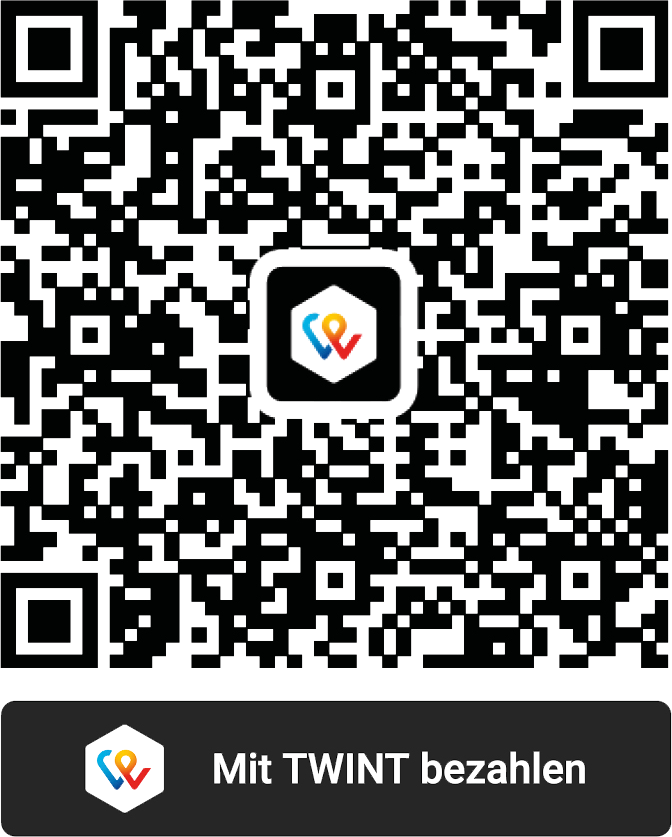Ein Frauenbild, das immer noch viele Männer haben, sagt Leena Hässig. Dies und viel anderes bemängelt die Gewaltberaterin und Psychologin an der aktuellen gesellschaftlichen Realität. Mit diesem Interview starten wir die Serie «Im Korsett», die während der nächsten Monate Einblicke in die beklemmende Welt der Frauen gibt.

Leena Hässig ist eine Expertin, wenn es um Gendergewalt und Traumatherapie geht. Sie arbeitete über dreißig Jahre lang beim Forensisch-Psychiatrischen Dienst der Universität Bern und war Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtspsychologie sowie der Berufsethikkommission der Föderation Schweizer Psychologen. Als erste Psychologin im Schweizer Frauengefängnis Hindelbank war sie mehr als zwanzig Jahre mit gewaltausübenden Frauen konfrontiert und wurde bei emblematischen Fällen wie dem der Parkhaus-Mörderin hinzugezogen. Heute gibt die 66-Jährige ihre Erfahrung und ihre Expertise in verschiedenen Gremien weiter, etwa als Gewaltberaterin bei der Fachstelle Gewalt Bern. Außerdem ist sie als Psychotraumatologin tätig und leitet als Präsidentin die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern, die unter anderem zwei Frauenhäuser betreibt. Hässig kennt also auch die andere Seite der Gewalt. Die der Frauen, die Schutz und Gehör brauchen.
•••
Was bedeutet für Sie Frauenfeindlichkeit, beziehungsweise: Wie wirkt sie sich konkret aus?
Leena Hässig: Feindlichkeit ist ein starker Ausdruck, der nicht nur eine dahinterliegende Haltung impliziert, sondern auch eine Intention. Wenn wir darüber sprechen, wie Frauen in der Gesellschaft behandelt werden, kann sich dies auch an sehr subtilen Beispielen zeigen, wobei das natürlich je nach Kontext und Kultur unterschiedlich ist. Ein typisches Beispiel ist für mich ein Erlebnis, das ich vor ein paar Jahren hatte: Ich schlitterte bei eisigen Straßenverhältnissen in ein anderes Auto hinein, und als die Polizei kam, sprachen die Beamten nur mit meinem Mann – obwohl ich gefahren bin. Das ist eine Form der Entmündigung von Frauen, die sich viele Männer sozusagen einverleibt haben: Frauen wird keine Sozialkompetenz zugeschrieben. Im Gegensatz zu Männern werden sie nicht als handlungswirksam betrachtet.
Und das hat sich in der Gesellschaft so normalisiert, dass es dem Einzelnen, zum Beispiel dem Polizisten, gar nicht mehr bewusst ist?
Ja, oft geht es um Automatismen, die zeigen, dass die Frau einfach nicht den gleichen Stellenwert hat.
Inwiefern lässt sich in der Schweiz eine strukturelle, das heißt systemische Diskriminierung von Frauen feststellen?
Einerseits in der Berufswelt, zum Beispiel in Bezug auf die Lohnungleichheit oder die verminderten Möglichkeiten, in eine Kaderposition aufzusteigen. Anderseits in der Gesetzgebung, zum Beispiel bei der Altersvorsorge. Diese Themen sind ja hinlänglich bekannt. Ein anderer zentraler Bereich ist für mich die Diskriminierung in der Forschung, die hauptsächlich auf den Mann ausgerichtet ist. Das Paradebeispiel ist der Herzinfarkt, bei dem Frauen ganz andere Symptome zeigen. Bis dieser Aspekt Eingang in die Forschung fand, hat es sehr lang gedauert. Ähnlich ist der Fall bei Gewalttäterinnen, deren Taten – ähnlich wie beim Herzinfarkt – nach männlichen Konzepten eingestuft werden.
Worin unterscheiden sich diese?
Bei Frauen ist der soziale Kontext entscheidend. Wenn Frauen gewalttätig werden – was prozentual viel weniger häufig vorkommt – ist das meist eine Reaktion auf eine bedrohliche, ausweglose Situation, in der sie sich hilflos fühlen. Deshalb ist es bei der Beratung und Behandlung von Gewalttäterinnen zentral, den Aspekt der sozialen Diskriminierung miteinzubeziehen. Diese muss in unserer Gesellschaft aufgearbeitet werden.
Und das passiert zu wenig?
Ich habe das zwanzig Jahre lang mantramäßig in jedem Fachgremium diskutiert, bis das Eidgenössische Büro für Gleichstellung dann in einem Jahresbericht schrieb, es sei Forschungsarbeit nötig zum Thema Frauen, die Gewalt anwenden. Schließlich ist das Thema des Strafvollzugs ja die Reintegration – und die Frauen kommen in eine Gesellschaft zurück, in der diese Ungleichheiten und Diskriminierungen weiterhin bestehen. Das kann auf diese Frauen wie ein Trigger wirken. Besonders wenn sie schon früher aus Hilflosigkeit gewalttätig geworden sind. Männer dagegen kommen in ein soziales Umfeld, in dem ihnen Sozialkompetenz zugeschrieben wird – sie finden sich nicht in einer Situation von Hilflosigkeit wieder. Deshalb habe ich ein Lernprogramm für Frauen entwickelt, die zu Gewalttäterinnen geworden sind. Dort findet nicht nur Gewaltberatung statt, sondern wir befassen uns auch mit dem Thema der gesellschaftlichen Entmündigung der Frau.
Wäre das bei Männern nicht auch nötig?
Bei einigen schon – doch die meisten Männer werden nicht aus Hilflosigkeit gewalttätig, sondern aus einem Machtbedürfnis heraus. Das ist bei Frauen sehr selten.
«Es ist äußerst fragwürdig, dass ein gewalttätiger Elternteil automatisch das Kontaktrecht zu seinen Kindern behält.»
Gibt es noch andere Bereiche, in denen Frauen systematisch diskriminiert werden?
Zum Beispiel in der klischeehaften Erwartungshaltung, dass Frauen hübsch, attraktiv und pflegeleicht sein sollen und dabei Haushalt und Kinder im Griff haben müssen. Alles Dinge, die als selbstverständlich gesehen und gleichzeitig überhaupt nicht wertgeschätzt werden. Ein Mann, der den Müll nach unten bringt und ab und zu auf die Kinder aufpasst, wird fast als Weltwunder betrachtet. Genauso wie eine Frau in einer Kaderposition. Ich spreche in diesen Fällen jedoch eher von Ungleichbehandlung als von Diskriminierung.
Was ist der Unterschied?
Diskriminierung ist eine Tat. Wer diskriminiert, tut dies mit der vorsätzlichen Absicht, abzuwerten und zu erniedrigen. Es hat also etwas Boshaftes. Ungleichbehandlung dagegen ist ein Status quo in unserer Gesellschaft. Kurzum: Ungleichbehandlung passiert ohne böse Absicht, kann jedoch ebenfalls zu Diskriminierung führen. Wie man damit umgeht und ob man selbst andere diskriminiert, das entscheidet jeder und jede für sich.
Warum ist diese Ungleichbehandlung heute immer noch so stark – und was müsste passieren, damit sich dies ändert?
Es geht hier um eine jahrhundertelange Tradition. Man muss sich vorstellen, dass Frauen erst seit der Änderung des Ehegesetzes 1988 ohne die Einwilligung ihres Mannes arbeiten gehen können. Dabei repräsentieren Gesetze die Grundhaltung einer ganzen Gesellschaft. Doch solche Veränderungen brauchen sehr viel Zeit. Ich kann mich gut erinnern, wie wir damals für Elisabeth Kopp auf die Straße gingen – und heute ist eine Frau im Bundesrat kein Thema mehr. Wie wir von der Tradition der Ungleichbehandlung wegkommen? Indem wir sie immer wieder thematisieren. Wichtig ist aber, dass nicht polarisierend diskutiert wird, sondern Fakten in den Raum gestellt werden. Wenn man Missstände als Angriff deklariert, muss die andere Seite sich verteidigen, und das führt nicht zu einer konstruktiven Diskussion. Es gibt jedoch sehr vieles, das nicht offen diskutiert wird.
Zum Beispiel?
Häusliche Gewalt und die entsprechende Gesetzgebung. Für mich ist es in diesem Zusammenhang äußerst fragwürdig, dass ein gewalttätiger Elternteil automatisch weiterhin das Kontaktrecht zu seinen Kindern behält.
Gibt es zu wenige Frauen in Entscheidungspositionen, dass solche Gesetze bis heute gelten?
Ich kann mir vorstellen, dass es in der Legislative zu wenig Frauen gibt, die sich für diese Themen einsetzen könnten. Auch weil man sich extrem exponiert, wenn man sich auflehnt und Missstände beim Namen nennt.
Haben Sie das selber auch erlebt?
Hundert Mal (lacht). Ich bin immer wieder angefeindet worden, weil ich auf der fachlichen Ebene Stellung bezogen habe und eben nicht «pflegeleicht» war.
Was würden Sie sich von den Männern wünschen, um die Gender-Ungleichheiten zu beseitigen?
Dass sie lernen, gut zuzuhören, und ernstnehmen, was Frauen empfinden und ausdrücken. Das heißt: mehr Interesse zeigen an der Erlebniswelt der Frauen. Die Männer müssen sich auch bewusstwerden, dass die Erlebniswelt der Frauen eben anders ist als ihre eigene. Die türkische Autorin Elif Shafak sagt in ihrem Buch «Hört einander zu!»: «Gehört werden wollen ist das eine, zuhören wollen das andere.» In diesem Sinne ist es wichtig, dass bestehende Missstände offen angesprochen werden und dann darüber diskutiert wird. Und man sich dabei gegenseitig zuhört. Es geht nicht darum, die einen an den Pranger zu stellen und selbst nicht die Verantwortung für seine Bedürfnisse zu übernehmen – beide Seiten müssen sich gemeinsam um Lösungen bemühen. Es darf nicht sein, dass das männliche Bedürfnis der Dominanz über den Bedürfnissen der Frauen steht.
Kann Diskriminierung auch generiert oder zementiert werden, weil man Ungleichheit thematisiert?
Es gibt zahlreiche Situationen, in denen Frauen benachteiligt, übergangen, entmündigt, missbraucht und bedroht werden und ungehört bleiben. Diese Beispiele, diese Fakten, müssen immer wieder ausgesprochen und gehört werden, ansonsten wird die strukturelle Diskriminierung der Frauen auch weiterhin bestehen. In diesem Zusammenhang gibt es allerdings ein Phänomen, das ich spannend finde. Udo Rauchfleisch, ein emeritierter Professor aus Basel, hat einmal gesagt: Sowohl Opfer und Täter werden, ganz nach dem Prinzip des Sadismus und Masochismus, entweder dämonisiert oder bagatellisiert. Das heißt: Für die einen ist das Opfer selber schuld, und die anderen sagen, es muss beschützt werden. Und hier sind wir wieder bei der Hilfslosigkeit. Die einzige Möglichkeit, dies ins Lot zu bringen und eine einseitige Perspektive zu verhindern, ist eine offene Diskussion. ♦
Dieser Text hat Ihnen gefallen?
Die Inhalte von Tentakel sind frei verfügbar. Vielen Dank, wenn Sie unsere Arbeit mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Per Twint oder mit einem Klick auf den Button.